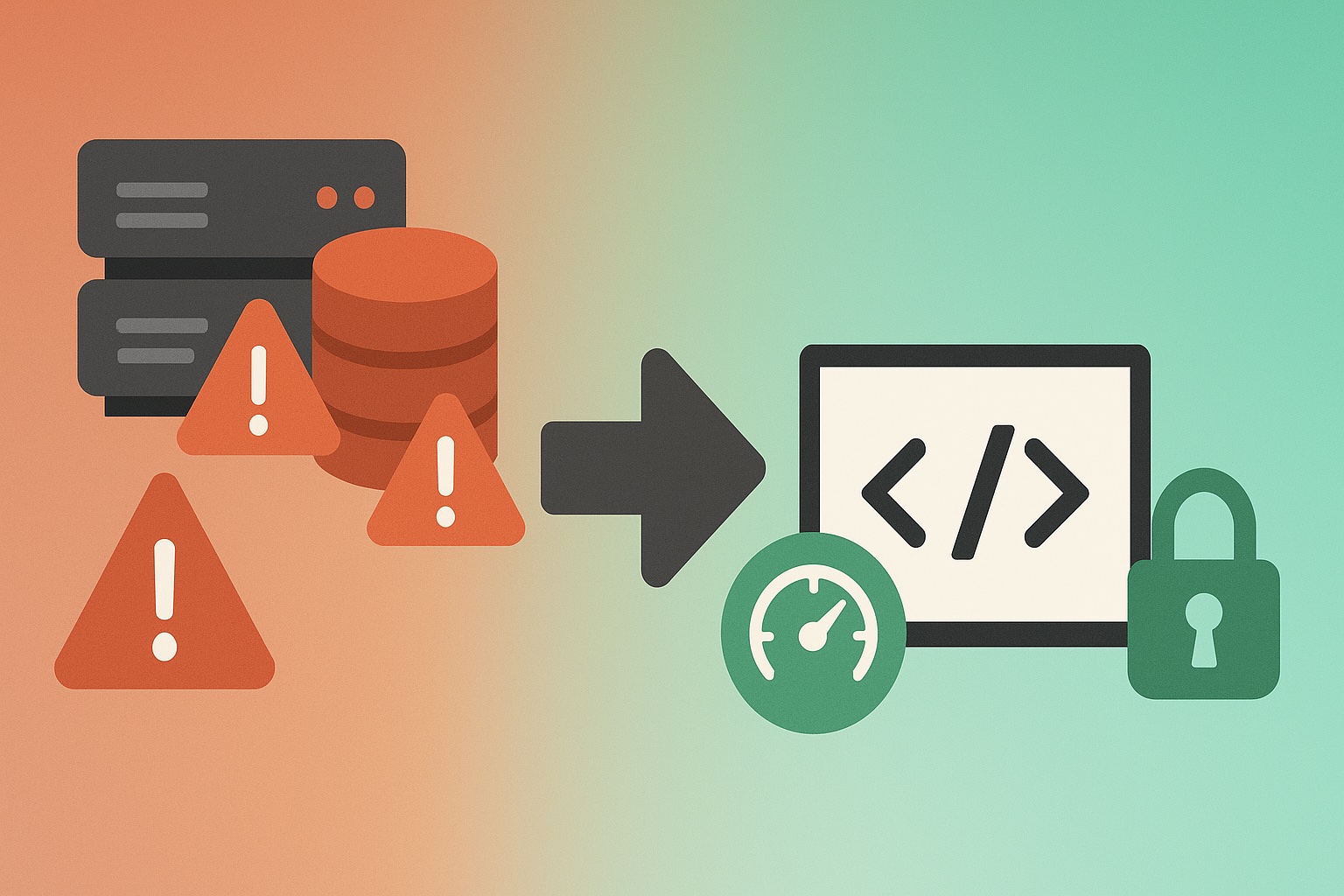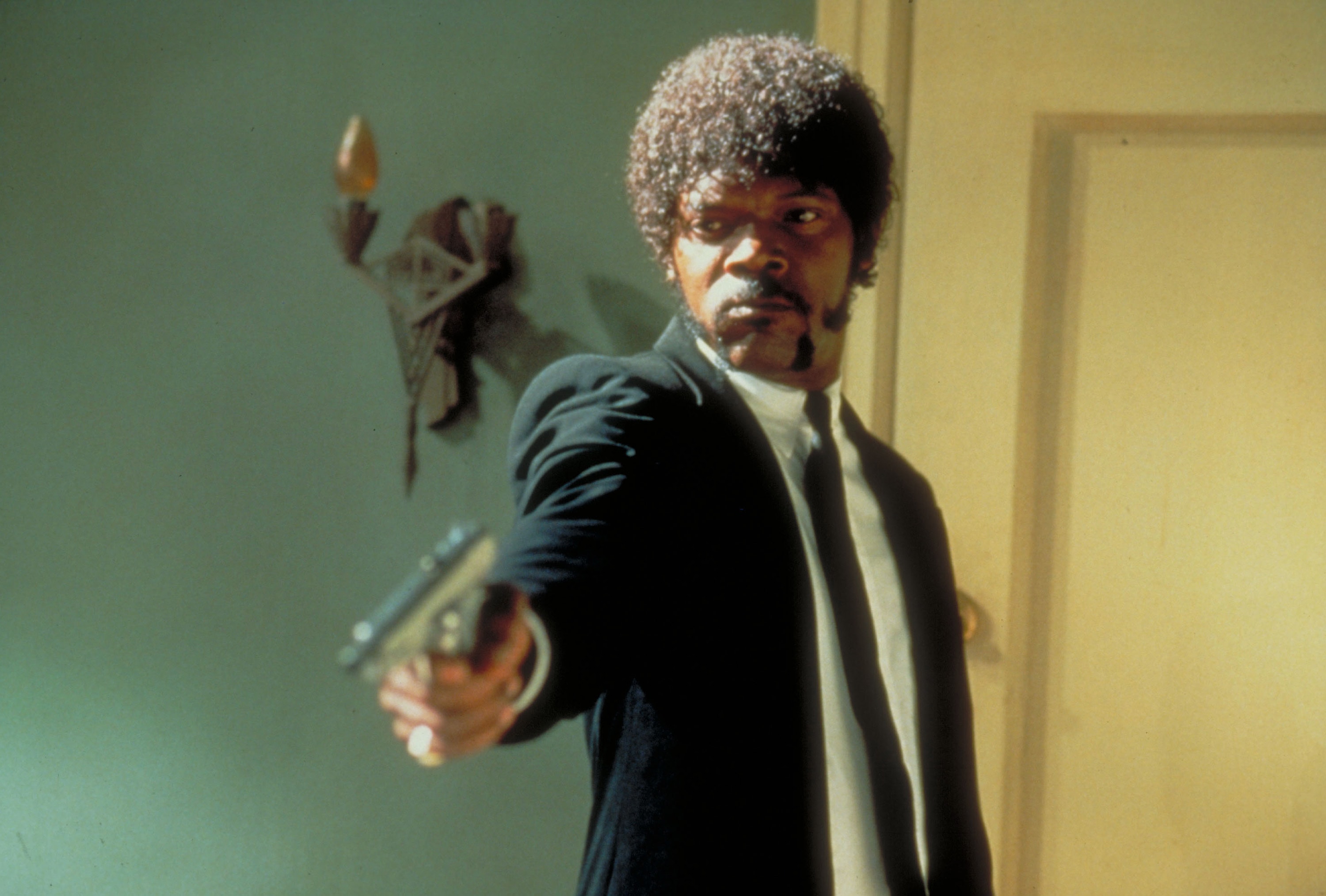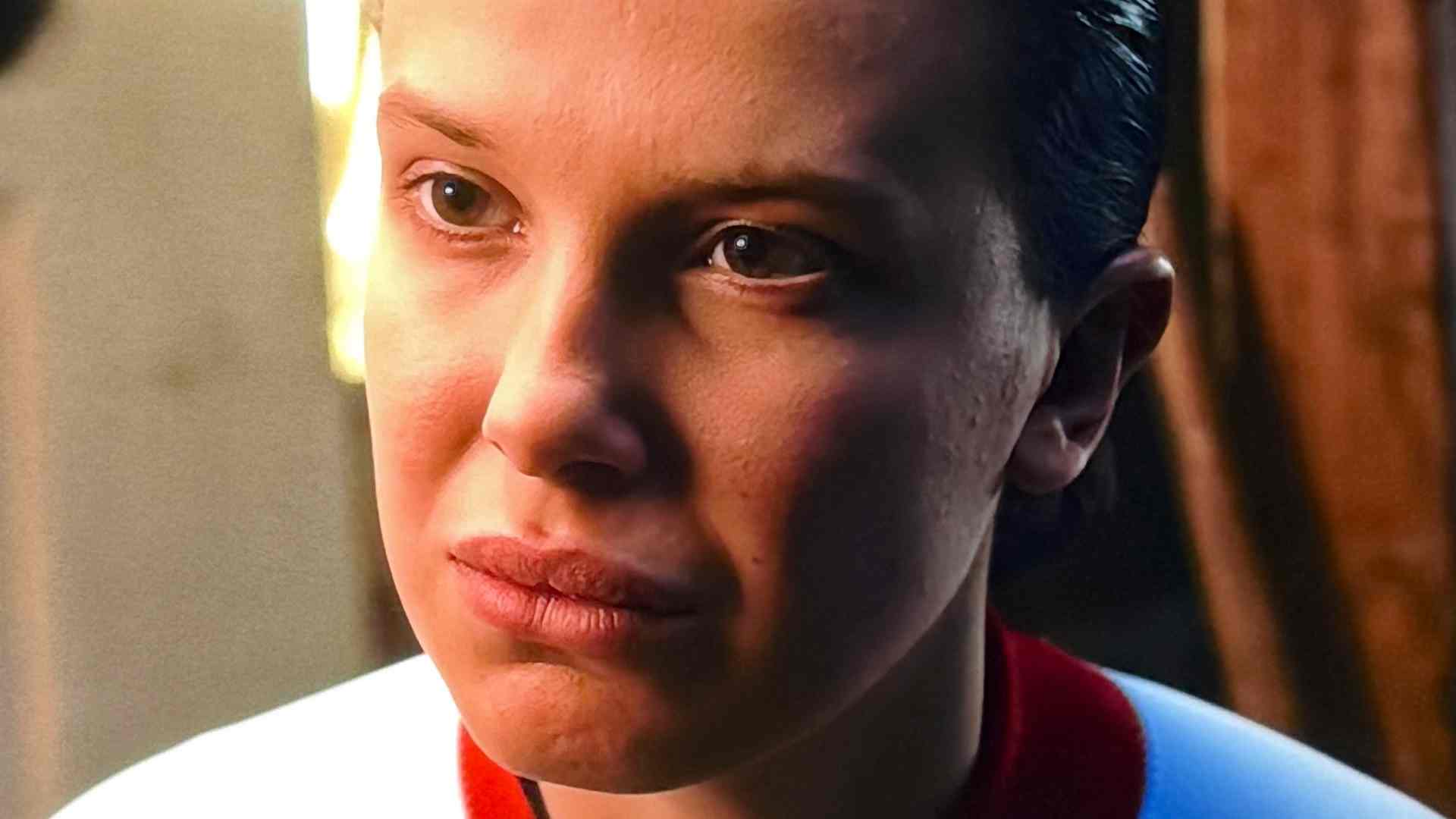Man of Steel (2013) vs. Superman (2025): Warum Snyder fliegt – und Gunn das Superheldenkino entkernt
Plot & Erzählweise: Zwei Mythen, zwei Methoden – und nur eine funktioniert
Wenn man Zack Snyders „Man of Steel“ (Warner Bros.; Story: Christopher Nolan, Drehbuch: David S. Goyer, Kamera: Amir Mokri, Musik: Hans Zimmer) direkt neben James Gunns „Superman“ (DC Studios/Warner Bros.; Hauptrollen: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult) legt, erkennt man nicht zwei gleichwertige Ansätze desselben Mythos, sondern ein Lehrstück in Dramaturgie. Snyder baut ein kohärentes Sci-Fi-Drama auf, das den Mythos von innen her erneuert. Gunn serviert ein Alles-auf-einmal-Reboot, das dich mit Information überschüttet, ohne dich fühlen zu lassen, warum irgendetwas zählt. Der Effekt: Man of Steel erinnert mich daran, warum Superheldenfilme funktionieren. Superman (2025) demonstriert, wie man sie aus hohler Betriebsamkeit heraus kaputt macht.
Charaktere & Schauspiel: Cavill trägt, Corenswet blitzt – doch die Architektur fehlt
Was Snyder als erstes richtig setzt: Erzählrhythmus. Man of Steel beginnt mit einem Krypton-Prolog, der nicht nur Schauwert ist, sondern das moralische Gefüge des Films legt: Jor-El (Russell Crowe) gegen General Zod (Michael Shannon) – Ethos vs. Biologie, freier Wille gegen Zuchtprogramm. Wenn der Film dann auf die Erde schneidet, pendelt er zwischen Gegenwart und Smallville-Erinnerungen, nicht aus schicker Laune, sondern damit Emotion, nicht Chronologie, die Dramaturgie bestimmt. Ein Junge lernt, was es heißt, anders zu sein; ein Mann versucht, dieser Andersartigkeit Bedeutung zu geben. Diese Struktur lässt Henry Cavill mehr spielen als nur Pose: Er ist Wanderer, Sohn, Beschützer – und ja, ein Gott auf Erden.
Die Väter prägen ihn. Jonathan Kent (Kevin Costner) ist kein reines Kitschbild, sondern der Mann, der das Gewicht des Geheimnisses kennt und einen Sohn lehren muss, wann Nicht-Handeln die schwerere Entscheidung ist. Jor-El dagegen ist Vision und Vermächtnis – ein Geist, der nicht nur Guiding-AI, sondern moralische Stimme ist. Martha Kent (Diane Lane) erdet das Ganze: „Sei du selbst, aber entscheide, wer dieses Selbst ist.“ In dieser Triangulation entsteht Clark, nicht in einem Montage-Clip, sondern im Konflikt.

Wichtig: Lois Lane (Amy Adams) ist kein Plot-Objekt. Sie recherchiert, konfrontiert, handelt – eine Pulitzer-Journalistin, die die Wahrheit freilegt und damit die Handlung aktiv vorantreibt. Perry White (Laurence Fishburne) bringt Stahl und Integrität ins Daily Planet, und Zod ist nicht „machtgeil“ im Cartoon-Sinn, sondern ideologisch gezüchtet: ein Produkt einer untergehenden Kultur, die ihn zum Krieger gemacht hat. Faora (Antje Traue) ist ein Messer, kalt und zielstrebig. Dieses Ensemble ist nicht breit, sondern präzise: Jede Figur spiegelt eine Facette von Clarks Dilemma.
Visuelle Gestaltung & Action: Wucht mit Geografie vs. CGI-Treibsand
Snyders Bildsprache trägt diese Präzision. Mokris Kamera hat Textur, Korn, Luft; das Production Design macht Krypton fühlbar – Biotech-Ornamentik, organische Instrumente, ein ganz eigener visueller Dialekt. Wenn die Kämpfe kommen, spürst du Gewicht. Die Schlachten in Smallville knirschen, die Zerstörung von Metropolis wirkt biblisch – und bleibt lesbar. Du weißt, wo oben und unten ist, wie weit die Figuren zueinander stehen; die Geografie bleibt nachvollziehbar. Massive VFX (ja, inklusive WETA-Arbeit) werden nicht zur Matsche, sondern bleiben inszeniert. Das ist Blockbuster-Handwerk: Körper im Raum, nicht nur Partikel im Rechner.
Sound & Musik: Neue Identität statt Jukebox-Nostalgie
Dazu Hans Zimmer. Statt Williams zu imitieren, gibt er Superman eine neue Klangidentität: mechanischer Puls, Percussion, ein Thema, das nicht nach Fanfare greift, sondern den inneren Takt von Clark Kent aufnimmt – das Werden, nicht das Schon-Sein. Genau deshalb trägt der Score Szenen, die sonst in Pathos versacken könnten. Er verankert das Erhabene im Körperlichen.
Themen & Botschaften: Identität mit Konsequenz vs. Referenz ohne Resonanz
Themen? Identität, Herkunft, Glaube. Der Film spricht die Immigrantenerfahrung aus, nicht als Didaktik, sondern als Blick auf einen Fremden, der Heimat baut, indem er entscheidet, wofür er steht. Ja, es gibt Christus-Bildsprache (Alter, Kirche, Opfer). Entscheidend ist aber, wie Konsequenz erzählt wird: Zods Tod ist keine Triumphpose, sondern eine Narbe. Der Schrei danach ist kein „cooler Beat“, sondern der Moment, in dem aus Macht erstmals Verantwortung wird – endgültig, schmerzhaft, prägend.

Jetzt der harte Schnitt zu James Gunns „Superman“. Das Problem ist nicht „Ton“ an sich – Leichtigkeit kann großartig sein. Das Problem ist Takt und Priorität. Der Film setzt mittendrin ein: Clark (David Corenswet) ist seit drei Jahren Superman; Lois (Rachel Brosnahan) weiß längst Bescheid; sie sind schon ein Paar; Lex Luthor (Nicholas Hoult) ist fertig gebacken; Metahumans sind Alltagsdeko. On-Screen-Texttafeln sagen dir, was vorher alles passiert ist, wo du bist, wer wen kennt – als ob das Universum eine Menükarte wäre. Sogar Supermans erste Niederlage passiert off-screen und wird dir nachgereicht. Das fühlt sich nicht an wie „Fett wegschneiden“, sondern wie Charakter wegschneiden.
Und dann die Dramaturgie der Fülle: Mr. Terrific (Edi Gathegi), Guy Gardner/Green Lantern (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merced), The Engineer (María Gabriela de Faría), eine Justice Gang, Krypto, ein Pocket-Universe, ein schwarzes Loch, sogar ein Kaiju-Einsprengsel – und das ist nur die Oberfläche. Vieles davon ist für sich genommen reizvoll, aber zusammen entkernt es die Hauptfigur. In der zweiten Hälfte steht nicht mehr Superman im Zentrum, sondern ein Konflikt-Karussell, das um ihn herum kreiselt. Das schwarze Loch schluckt nicht nur einen Antagonisten, sondern auch die Konsequenz – als hätte das Script Angst vor Nachklang.
Tonlage: Statt Vertrauen in die eigene Geschichte brummt der Film wie ein Nostalgie-Jukebox-Musical. Du hörst bekannte Fanfaren, spürst die Geste „Wir bringen die Hoffnung zurück“ – und siehst Bilder, die dem Versprechen nicht gerecht werden. Witz ist willkommen; Witz als Reflex frisst Sinn. Pointen fallen dort, wo Ernst nötig wäre; Ironie quert, wo Haltung gefragt wäre. So entsteht Schein-Leichtigkeit: Du lächelst – und vergisst die Szene in dem Moment, in dem sie endet.
Lex Luthor ist hier Memes statt Motiv: zornig, narzisstisch, tech-bro’isch – alles ankonstruiert, kaum entwickelt. Perry White (Wendell Pierce) läuft am Rand mit, Jimmy Olsen (Skyler Gisondo) verheddert sich in einer falsch gewichteten Nebenidee. Brosnahan blitzt immer dann, wenn der Film sie wirklich recherchieren lässt – die Interview-Szene zu Beginn zeigt, was dieses „romantische Abenteuer mit Investigativ-Kern“ hätte sein können. Corenswet hat Charme, Präsenz, den richtigen klassischen Zuschnitt. Gathegi bringt als Mr. Terrific Energie. Aber Leistungen können nur anheben, nicht architekturieren, was das Drehbuch nicht sauber baut.
Visuell startet Gunns Film hell und bunt, energetisch, eine Weile sogar verspielt erfindungsreich. Doch zum Finale hin kippt das in CGI-Treibsand: Lauter, größer, schneller – aber ohne räumliche Klarheit. Wo Snyder die Geografie schützt, zerschellen hier Körper und Räume in Effekt-Kaskaden, die dich zwar schwindeln lassen, aber selten berühren. Wenn eine Action-Set-Piece nicht nur dein Auge, sondern auch deine Aufmerksamkeit verliert, ist das ein Regieproblem, kein VFX-Problem.
Inhaltlich blinzelt der Film in Richtung Geopolitik – fiktive Länder (Boravia, Jarhanpur), Drohnen-Ethik, karzerale Allegorie über ein Pocket-Universum. Klingt aufregend, wird aber Deko. Die Motive dienen als Gerüst, auf dem dann Gags und Set-Pieces montiert werden, statt als Motor, der Entscheidungen und Konsequenzen antreibt. Es bleibt beim Anreißen, beim „So etwas gibt’s hier auch“, ohne dass du je das Gefühl bekommst, Superman müsse an einer klaren Wertefrage wachsen.
Genre-Vergleich: Klassik modernisiert vs. Formel vergessen
Vergleiche helfen: Man of Steel denkt wie „The Dark Knight“ – Mythos als moralischer Stresstest – und spielt die epische Skala mit mehr Durchblick als „Transformers“, während die Wucht der Action in meinen Knochen landet. Es toppt den Bombast von „The Avengers“, aber verschweißt Spektakel mit Charakterimpuls. „Iron Man 3“ zeigt, wie Humor und Trauma atmen können; Snyder geht weniger quippig, dafür entschlossener vor – und gewinnt Ernst ohne Zynismus. Gunn zielt scheinbar auf die Donner-Leichtigkeit von 1978, doch Leichtigkeit ohne Überzeugung wird zur Nostalgie-Attrappe.
Warum Man of Steel der deutlich bessere Superheldenfilm ist
Weil er die klassische Form respektiert und modernisiert, statt sie zu überladen. Setup → Entscheidung → Konsequenz: Krypton legt das Thema, Smallville formt den Charakter, Metropolis testet ihn. Lois hat Agency, Zod ist logisch motiviert, Faora setzt Messerschnitte, Martha wärmt, Perry stützt, Clark entscheidet – und zahlt den Preis. Zimmer komponiert Identität, nicht Nostalgie. Die Action ist lesbar, hat Gewicht, nicht nur Lautstärke. Und am Ende markiert ein Schrei den Punkt, an dem Superman Superman wird – nicht durch einen Spruch, sondern durch eine Last, die er fortan trägt.
Warum macht „Superman“ (2025) Superheldenfilme kaputt?
Weil er die Illusion verkauft, die Form hätte sich „überlebt“, und deshalb müsse man sie mit Inhalten zuschütten. Er verwechselt Dichte mit Tiefe, Referenz mit Bedeutung, Tempo mit Dramatik. Wenn dein Titelheld in der zweiten Hälfte zur Nebenfigur im eigenen Film wird, wenn Entscheidungen durch Intertitel ersetzt werden, wenn Konsequenzen im CGI-Sturm verdampfen, wenn Musik Erinnerungslücken stopfen muss – dann hast du nicht „das Alte hinter dir gelassen“, sondern vergessen, warum es überhaupt funktionierte.
Und ja: Ich mag Corenswet in der Rolle. Ich mag Brosnahan als Lois, wenn der Film sie lässt. Ich habe sogar ein Herz für Krypto. Aber all das sind Inseln. Ein Genre lebt nicht von Inseln, sondern von Brücken: von Entscheidungen, die zu Konsequenzen führen, von Figuren, die die Erzählung ziehen, nicht umgekehrt. Man of Steel baut diese Brücken mit ruhiger Hand. Superman (2025) reißt sie ein und hofft, dass der Sprint über den Abgrund schon klappen wird.
Roger Ebert hat oft gesagt: Es geht nicht darum, worüber ein Film ist, sondern wie er darüber ist. Man of Steel ist über Werden – und zeigt es dir in Bild, Ton und Handlung. Superman (2025) ist über das Schon-Sein – und erzählt es dir auf Texttafeln, während die Handlung in Nebenbahnen schießt. Wenn das neue DCU ein Herz braucht, sollte es nicht bei 1978 stehen bleiben, sondern bei 2013 lernen: an den Mythos glauben, ihn durch Charakter und Bild ausbuchstabieren, statt ihn mit Lärm zu übertönen. So rettest du ein Genre.
Snyders Film erinnert sich daran.
Gunns Film nicht.
📽️ Hinweis zu meinen Reviews: Ich schaue alle Filme in meinem eigenen Heimkino – mit Marantz Cinema 70s Receiver mit Dolby Atmos Simulation, Jamo 7.1 Surround-Sound, einem JVC DLA-X35 Projektor mit einer 3 Meter großen Leinwand und echten Kinosesseln, die das Home Cinema in einen Saal verwandeln. Jede Kritik entsteht also unter Bedingungen, die so nah wie möglich am echten Kinoerlebnis liegen. Wie ich mein Home Cinema aufgebaut habe und warum es für mich das Herz des Filmgenusses ist, erfährst du hier:
Mein Heimkino-Erlebnis

 By Jakob Montrasio
By Jakob Montrasio