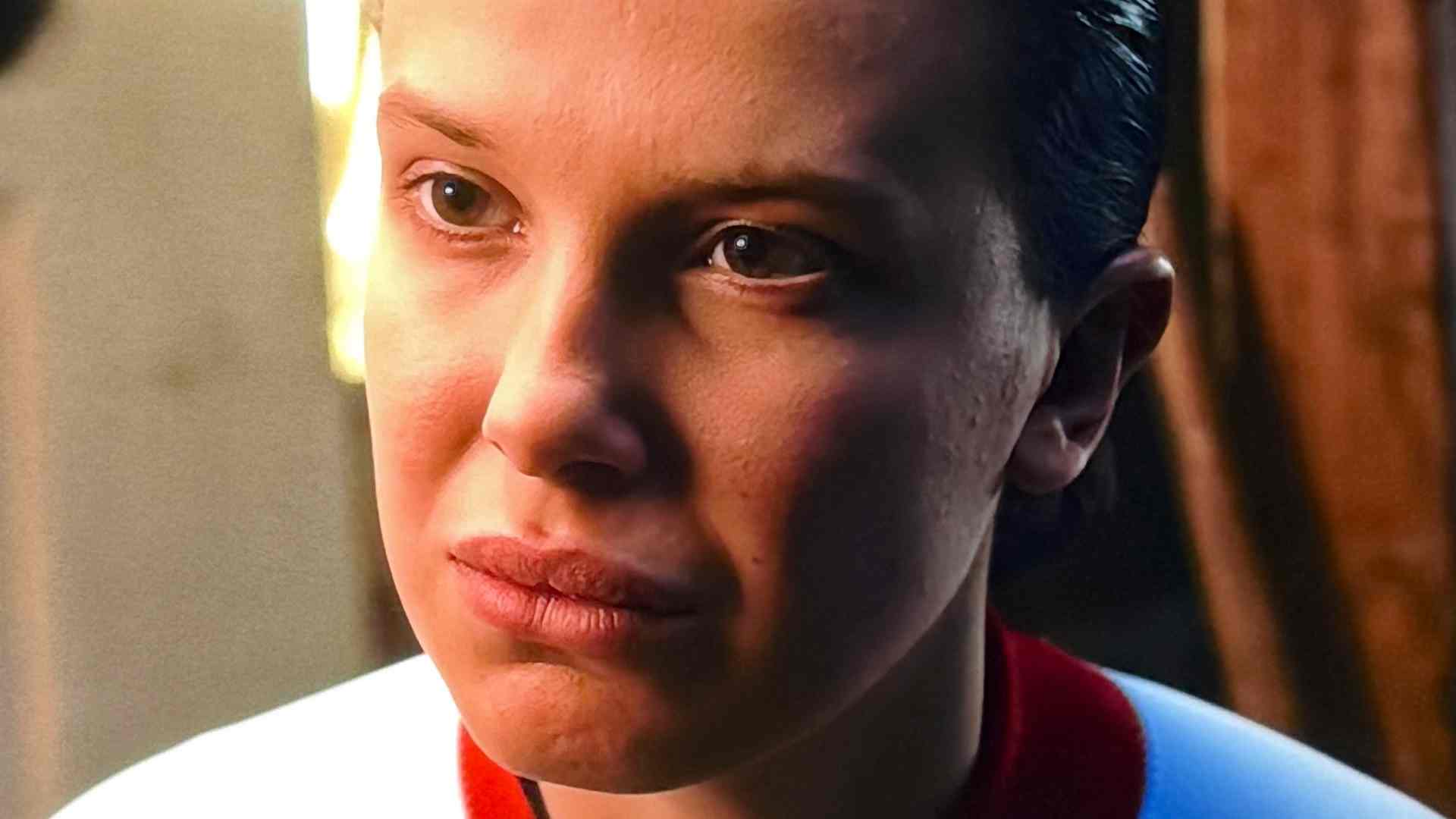Der doppelte Ursprung der Vereinigten Staaten
Die Geburtsstunde der Vereinigten Staaten war von einem fundamentalen Widerspruch geprägt: Während in der Unabhängigkeitserklärung von 1776 universelle Menschenrechte beschworen wurden, blieben diese Rechte faktisch einer weißen Minderheit vorbehalten. Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit wurden zum ideellen Fundament – gleichzeitig beruhte die neue Nation auf der Ausbeutung versklavter Menschen und der gewaltsamen Verdrängung indigener Bevölkerungen.
Die Gleichzeitigkeit von idealistischer Rhetorik und strukturellem Unrecht zeigt sich nicht nur in den politischen Texten der Gründerzeit, sondern auch in deren konkretem Handeln. Viele der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung hielten selbst Sklaven. Während sie von universellen Rechten sprachen, war die Rechtsordnung gezielt darauf ausgelegt, die Freiheit auf eine exklusive Gruppe zu begrenzen. Freiheit bedeutete damals vor allem die Möglichkeit weißer Siedler:innen, sich Land anzueignen – meist auf Kosten derer, die dieses Land zuvor bewohnten.
Die frühe amerikanische Demokratie war deshalb nicht nur ein Projekt der Selbstbestimmung, sondern auch ein System, das systematische Entrechtung legitimierte. Die Verurteilung indigener Völker als „gnadenlose Wilde“ in der Unabhängigkeitserklärung deutet auf eine tief verankerte koloniale Logik hin, die gewaltsame Expansion zur staatsbildenden Praxis erhob.
Die Vorstellung, dass ein Staat gleichzeitig auf der Idee von Freiheit und auf der Realität von Sklaverei und Landraub gründen kann, gehört zu den prägendsten Paradoxien der amerikanischen Geschichte. Dieses doppelte Erbe wirkt bis heute nach – nicht als historische Fußnote, sondern als strukturelles Fundament, das weiterhin soziale und politische Spannungen nährt. Die Frage ist daher nicht, ob Amerika diesem Widerspruch entkommen kann, sondern wie es mit seiner fortbestehenden Wirkung umgeht.
Verfassung der Widersprüche: Freiheit als Versprechen auf Kredit
Die Gründergeneration der Vereinigten Staaten war sich der moralischen Kluft zwischen ihren Idealen und der Realität durchaus bewusst. Viele der führenden Köpfe rangen mit dem Widerspruch, ohne ihn zu überwinden. In der Verfassung taucht das Wort „Sklaverei“ nicht auf – ihr Prinzip jedoch wurde tief in das System eingeschrieben. Der sogenannte Drei-Fünftel-Kompromiss reduzierte versklavte Menschen auf Zählmasse, die politischen Einfluss sicherte, ohne Rechte zu gewähren. Damit wurde die Logik der Entrechtung nicht nur akzeptiert, sondern verfassungsrechtlich abgesichert.
Der innere Zwiespalt – Freiheit und Versklavung als zwei Seiten derselben nationalen Identität – war kein nachträglicher Fehler, sondern ein konstitutives Merkmal der amerikanischen Staatsgründung. James Madisons Beobachtung, dass der zentrale Konflikt der Verfassungsdebatte entlang der Linie „Sklavenhalterstaaten gegen freie Staaten“ verlief, legt offen, dass es von Beginn an weniger um einheitliche Prinzipien als um strukturelle Kompromisse ging. Abraham Lincolns berühmte Warnung, dass ein Haus, das zur Hälfte auf Sklaverei und zur Hälfte auf Freiheit gebaut ist, nicht bestehen kann, wurde lange ignoriert.
Statt einer offenen Auseinandersetzung mit dieser moralischen Schieflage setzte die politische Kultur auf eine Erzählung vom unbeirrbaren Fortschritt – eine Erzählung, die Martin Luther King Jr. als uneingelöstes Zahlungsversprechen bezeichnete. Die Verfassung und die Unabhängigkeitserklärung hätten allen Menschen Rechte zugesichert, doch für viele blieben diese Rechte ein leeres Versprechen. Der Versuch, diesen Schuldschein in der Ära nach dem Bürgerkrieg einzulösen, scheiterte an rassistischer Gesetzgebung, systematischer Gewalt und einer Politik des Rückzugs aus der Gleichstellung.
So blieb der fundamentale Widerspruch bestehen: Eine Nation, die sich auf universelle Freiheit beruft, hat ihre Grundlagen auf ungleiche Freiheit gebaut. Die Folge ist ein strukturelles Erbe der Ungleichheit, das nicht durch Symbolpolitik oder historische Distanz verschwindet. Wer den Anspruch auf Gerechtigkeit ernst nimmt, muss begreifen, dass eine über Jahrhunderte mitgetragen Schuld nicht durch Vergessen getilgt werden kann.
Der Fortschrittsglaube als Illusion: Amerikas Selbstbild im Schatten der Geschichte
Im 20. Jahrhundert etablierte sich das Bild der Vereinigten Staaten als moralische und wirtschaftliche Leitmacht – ein Narrativ, das historische Widersprüche überdeckte, statt sie aufzuarbeiten. Der Begriff des „American Century“ suggerierte nicht nur globale Vormachtstellung, sondern auch eine innere Reife: ein Land, das aus seinen Fehlern gelernt habe und nun die Welt zu Demokratie und Freiheit führen könne. Der Glaube an eine gottgegebene Sonderstellung Amerikas – gestützt durch militärische Siege, technologischen Fortschritt und wirtschaftlichen Aufschwung – wurde zur nationalen Erzählung.
Diese Selbstsicht ignorierte jedoch die gewaltsamen Voraussetzungen jenes Aufstiegs. Vom Mythos des „Manifest Destiny“ über die systematische Verdrängung indigener Völker bis hin zu den globalen Machtinterventionen des Kalten Krieges blieb die Vorstellung moralischer Überlegenheit ungebrochen – auch dort, wo sie auf einem Fundament historischer Gewalt ruhte. Die Nachkriegszeit, mit ihrem wirtschaftlichen Höhenflug und dem Aufkommen einer konsumorientierten Mittelklasse, verstärkte das Gefühl, der moralische Kompass Amerikas sei nun dauerhaft ausgerichtet.
Die Erfolge der Bürgerrechtsbewegung und gesellschaftlicher Reformen wirkten wie Belege für einen unaufhaltsamen Fortschritt. Die Vorstellung, dass sich die Gründungsversprechen nun einlösten – oder zumindest absehbar würden – verdrängte die Erkenntnis, dass strukturelle Ungleichheit nicht durch Einzelerfolge verschwindet. Der Glaube an das „Ende der Geschichte“ ließ wenig Raum für die systemische Kontinuität von Ausschluss und Ungerechtigkeit.
Der Mythos eines linearen moralischen Fortschritts erwies sich damit weniger als Ergebnis gesellschaftlicher Reflexion denn als kollektives Bedürfnis nach Versöhnung mit der eigenen Vergangenheit – ohne deren reale Konsequenzen tragen zu müssen. Was wie eine Erfolgsgeschichte erschien, war oft eine Erzählung, die Brüche und Verdrängung zur Bedingung ihres Funktionierens machte.
Der Preis der Selbstgewissheit: Wie ein Mythos die Realität verdeckte
Hinter der Fassade moralischer Überlegenheit entwickelte sich eine politische Kultur der Verdrängung. Im Kalten Krieg inszenierte sich die USA als Anführerin der „freien Welt“, während sie autoritäre Regime unterstützte, solange diese antikommunistisch agierten. Freiheit wurde zur außenpolitischen Parole – nicht zur konsistenten Praxis. Innenpolitisch diente der „American Dream“ als beruhigendes Narrativ, das strukturelle Ungleichheit verdeckte. Die wirtschaftlichen Programme des 20. Jahrhunderts – etwa das New Deal-System oder die Fördermaßnahmen nach dem Zweiten Weltkrieg – schufen Wohlstand, allerdings fast ausschließlich für weiße Amerikaner:innen. Die rassifizierte Ausgrenzung bei Wohnraumförderung und Bildungspolitik verstärkte die soziale Spaltung.
Die Erfolge der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er-Jahren wurden rasch als Abschluss einer Epoche verstanden, nicht als Beginn einer umfassenden Umverteilung von Chancen und Ressourcen. Rassismus wurde nach der Gesetzgebung für erledigt erklärt – obwohl er sich institutionell fortsetzte, nur weniger sichtbar. Diese Selbsttäuschung setzte sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion fort: Der Sieg über den Kommunismus wurde als Bestätigung eines überlegenen Gesellschaftsmodells gefeiert, das keiner grundlegenden Reform mehr bedürfe.
Doch unter dieser Oberfläche begannen sich tiefgreifende Risse zu zeigen. Die industrielle Basis schrumpfte, wirtschaftliche Ungleichheit nahm zu, und das Vertrauen in staatliche Institutionen erodierte – befeuert durch Erfahrungen wie den Vietnamkrieg oder den Watergate-Skandal. Während die politische Klasse noch vom globalen Triumph überzeugt war, verloren viele Menschen den Anschluss an das Versprechen von Teilhabe und Aufstieg.
Der Mythos des amerikanischen Sonderwegs begann zu bröckeln, als deutlich wurde, dass wirtschaftlicher Erfolg und moralischer Anspruch nicht dauerhaft voneinander zu trennen sind. Was als Gipfel des Fortschritts erschien, war vielfach das Ergebnis von Verdrängung – und das Fundament, auf dem diese Erzählung ruhte, erwies sich als brüchiger denn je.
Der Fortschritt als Trugbild: Wie sich ein Jahrhundert selbst täuschte
Das 20. Jahrhundert wurde oft als Beweis für Amerikas historische Bestimmung gelesen – als Siegeszug von Demokratie, Wohlstand und technologischem Fortschritt. Doch diese Erzählung blendete die inneren Widersprüche systematisch aus. Der Sieg im Zweiten Weltkrieg endete nicht in moralischer Klarheit, sondern mündete im Desaster von Vietnam. Wirtschaftlicher Aufschwung ging mit politischer Repression einher – etwa durch McCarthyismus und institutionalisierte Segregation. Während amerikanische Astronauten den Mond betraten, entzündeten sich in den Städten Proteste gegen Rassismus und Krieg. Technologischer Glanz diente vielfach dazu, gesellschaftliche Spannungen zu überdecken.
Die Idee des ständigen Fortschritts – vom 19. Jahrhundert bis zur globalen Führungsrolle im Kalten Krieg – funktionierte nur, solange die sozialen und ökologischen Kosten dieser Expansion ausgeblendet wurden. Vom Landraub an indigenen Gemeinschaften über militärische Interventionen bis zur Ausbeutung billiger Arbeitskräfte weltweit reichte die Kette jener, die im Namen der amerikanischen Ordnung marginalisiert wurden.
Mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts wurde das Bild von der unaufhaltsamen Aufwärtsentwicklung zunehmend brüchig. Die Anschläge vom 11. September, endlose Kriege, eine globale Finanzkrise und die Rückkehr geopolitischer Konkurrenz machten deutlich, dass die USA weder unverwundbar noch moralisch unanfechtbar waren. Die lange gepflegte Vorstellung, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, verlor ihre Überzeugungskraft.
Diese Desillusionierung wirkte umso stärker, weil sie nicht vorbereitet war. Der Glaube an moralische Unfehlbarkeit hatte eine offene Auseinandersetzung mit internen Missständen – von wachsender Ungleichheit bis zu strukturellem Rassismus – über Jahrzehnte verzögert. Als diese verdrängten Konflikte mit voller Wucht zurückkehrten, fehlten nicht nur politische Antworten, sondern auch ein kollektives Verständnis für ihre historische Tiefe. Das amerikanische Selbstbild, aufgebaut auf dem Mythos ewigen Fortschritts, fand sich in einer Realität wieder, die lange ignorierte Brüche nicht länger überdecken ließ.
Strategien der Spaltung: Wie politische Macht auf Misstrauen baute
Ab den 1970er-Jahren verschoben sich die politischen Grundlinien der Vereinigten Staaten tiefgreifend – nicht als Ausdruck gesellschaftlichen Fortschritts, sondern durch bewusste Instrumentalisierung von Angst und Ressentiment. Richard Nixons Aufstieg markierte einen Wendepunkt: Mit seiner „Southern Strategy“ zielte er darauf ab, weiße Wähler:innen im Süden, die zuvor den New Deal getragen hatten, für die Republikaner zu gewinnen – indem er ihre Ablehnung gegenüber der Bürgerrechtsbewegung indirekt bestätigte. Begriffe wie „law and order“ oder „states’ rights“ wurden zu Chiffren für eine Politik, die soziale Spaltung unter dem Deckmantel staatlicher Stabilität vertiefte.
Parallel dazu etablierte Nixons Regierung die sogenannte „War on Drugs“, deren erklärtes Ziel nicht primär Drogenbekämpfung war, sondern die politische Schwächung unbequemer Gruppen. Wie später öffentlich wurde, sollten gezielte Kriminalisierungen gezielt gegen Schwarze Bürger:innen und politische Gegner:innen aus der Antikriegsbewegung gerichtet werden. Der moralische Überbau – Kampf gegen Verbrechen und Drogen – diente dazu, staatliche Repression medial und juristisch zu legitimieren.
Diese Strategie war nicht nur kurzfristig erfolgreich, sondern veränderte die politische Kultur nachhaltig. Sie verknüpfte Sicherheitsdiskurse mit rassifizierten Feindbildern, schwächte demokratisches Vertrauen und legte die Grundlage für eine expansive Strafjustiz, deren Folgen bis heute spürbar sind. Die Kriminalisierung ganzer Bevölkerungsgruppen führte nicht nur zu massenhafter Inhaftierung, sondern prägte auch das öffentliche Bild von sozialen Problemen – als moralisches Versagen statt als strukturelle Ungleichheit.
Was als Reaktion auf die gesellschaftlichen Umbrüche der 1960er-Jahre begann, entwickelte sich zu einer dauerhaften Verschiebung des politischen Koordinatensystems: Weg von kollektivem Fortschritt, hin zu einer Politik, die auf Spaltung, Misstrauen und Kontrolle setzte – mit langfristigen Folgen für das demokratische Selbstverständnis des Landes.
Politik der Umverteilung von unten nach oben: Wie Ungleichheit zur Waffe wurde
Die politischen und wirtschaftlichen Umbrüche der 1970er- und 1980er-Jahre führten nicht zu einer neuen sozialen Balance, sondern zu einer systematischen Verfestigung von Ungleichheit. Nach dem Vertrauensverlust durch den Watergate-Skandal und einer Wirtschaftskrise, die besonders Arbeiter:innen und ärmere Haushalte traf, inszenierte sich Ronald Reagan als Befreier vom „Versagen“ des Staates. Seine zentrale Botschaft: Nicht Ungleichheit oder Deregulierung seien das Problem, sondern die Regierung selbst.
Reagans Politik folgte dieser Logik konsequent. Steuererleichterungen für Reiche, massive Deregulierung und der Abbau sozialstaatlicher Programme wurden als „Wiederherstellung amerikanischer Stärke“ verkauft. De facto jedoch führte diese Politik zu einer drastischen Umverteilung: Während die obersten 20 % der Bevölkerung ihren Reichtum stark vermehrten, verloren die unteren Einkommensgruppen messbar an Wohlstand. Gleichzeitig brach das industrielle Rückgrat vieler Regionen weg, Gewerkschaften verloren an Einfluss, und die Mittelklasse begann zu erodieren.
Statt diese Entwicklungen als strukturelles Problem zu benennen, wurden individuelle Schuldzuschreibungen zur politischen Taktik. Figuren wie die „welfare queen“ oder der „strapping young buck“ dienten als rassifizierte Narrative, um Armut zu moralisch codieren und staatliche Hilfe als Fehlanreiz zu delegitimieren. Soziale Programme wurden gekürzt, während Strafmaßnahmen ausgeweitet wurden – besonders in urbanen Gegenden, die von Armut und Drogenkrisen betroffen waren. Die Antwort auf soziale Not war nicht Fürsorge, sondern Bestrafung.
Dieser Kurs verschärfte das Gefühl politischer Ohnmacht und gesellschaftlicher Spaltung. Wo wirtschaftliche Unsicherheit zunahm, kehrte sich Misstrauen gegen Institutionen, nicht gegen jene, die diese Umverteilung gestalteten. Die Kombination aus wachsender Ungleichheit, kultureller Spaltung und politischer Entfremdung erzeugte einen Zustand chronischer Instabilität – in dem soziale Solidarität zunehmend durch Misstrauen ersetzt wurde. Was als konservative Erneuerung begann, hinterließ ein politisch fragmentiertes Land mit tiefgreifenden strukturellen Schäden.
Die Architektur der Spaltung: Wie Medienmacht Demokratie untergrub
Ein oft übersehener, aber entscheidender Wendepunkt in der Erosion demokratischer Verständigung war das Ende der Fairness Doctrine im Jahr 1987. Jahrzehntelang hatte diese Regelung Rundfunkanstalten verpflichtet, kontroverse Themen ausgewogen zu präsentieren. Mit ihrer Abschaffung durch die Reagan-Regierung fiel ein zentrales Bollwerk gegen einseitige Berichterstattung. In der entstehenden Lücke wuchs ein neuer Medientyp heran: konservativ, konfliktgetrieben, meinungsstark – und zunehmend immun gegen Widerspruch.
Talkradio-Größen wie Rush Limbaugh prägten diese Entwicklung ebenso wie später der Fernsehsender Fox News. Sie boten nicht bloß alternative Perspektiven, sondern geschlossene Weltbilder – Medienräume, die keine Debatte mehr suchten, sondern Identität über Abgrenzung formten. Was entstand, war eine mediale Infrastruktur, die ideologische Loyalität über faktenbasierte Auseinandersetzung stellte. Millionen Menschen begannen, Nachrichten nur noch aus Quellen zu beziehen, die ihr bestehendes Weltbild bestätigten und politische Gegner:innen dämonisierten.
Diese „Parallelöffentlichkeiten“ veränderten nicht nur, wie Politik wahrgenommen wurde – sie veränderten, was als Realität galt. Forschungen belegen, dass selektive Berichterstattung nicht nur kurzfristige Stimmungen verstärkt, sondern langfristig Überzeugungen formt. Das Resultat war eine politisch aufgeladene Medienlandschaft, in der Polarisierung nicht nur Folge, sondern Ziel wurde. Der öffentliche Diskurs verrohte, nicht zuletzt durch politische Akteure wie Newt Gingrich, der Opposition als moralische Bedrohung inszenierte und damit parteipolitische Konflikte ins Fundament der Demokratie verlegte.
In diesem Klima gewannen populistische Narrative an Boden. Die Verbindung aus wirtschaftlicher Verunsicherung, kultureller Rückwärtsgewandtheit und medial verstärktem Misstrauen schuf eine politische Landschaft, in der rationale Auseinandersetzung zunehmend unmöglich wurde. Was fehlte, war nicht die Wut – sondern ein Akteur, der sie kanalisiert. Die Strukturen dafür waren längst gelegt.
Die Illusion des Fortschritts: Wie Obamas Aufstieg alte Ressentiments entfaltete
Die Wahl Barack Obamas im Jahr 2008 wurde von vielen als historischer Wendepunkt gefeiert – ein Zeichen, dass die USA ihre rassistische Vergangenheit hinter sich lassen könnten. Doch genau dieser symbolische Aufbruch machte sichtbar, wie tief die gesellschaftlichen Spaltungen tatsächlich reichten. Die Präsenz einer Schwarzen Familie im Weißen Haus wurde nicht nur als Zeichen des Fortschritts gelesen, sondern für viele auch als Provokation empfunden – als kultureller Kontrollverlust in einem Land, das sich ethnisch und sozial rapide wandelte.
Konservative Stimmen reagierten mit dem Versuch, Obamas Legitimität systematisch zu untergraben. Er wurde als fremd, gefährlich, „nicht wirklich amerikanisch“ dargestellt – Vorwürfe, die auf lange tradierte rassistische Erzählmuster zurückgriffen: Schwarze als Bedrohung, als illegitim, als nicht zugehörig. Die „Birther“-Bewegung, die fälschlich behauptete, Obama sei außerhalb der USA geboren, verdichtete diese Strategie zu einem offenen Angriff auf seine Staatsbürgerschaft – und damit auf seine politische Daseinsberechtigung.
Prominent vorangetrieben wurde diese Kampagne von Donald Trump, der damit seine politische Karriere begründete. Die Idee, dass ein Schwarzer Präsident die Nation nicht rechtmäßig führen könne, war keine Randerscheinung, sondern fand breite Resonanz: Umfragen zeigten, dass viele republikanische Wähler:innen die Verschwörung glaubten. Was als rassistische Polemik begann, wurde zum Instrument politischer Mobilisierung.
Obamas Präsidentschaft entlarvte damit nicht die Überwindung von Rassismus, sondern dessen fortbestehende Wirksamkeit. Der Glaube an eine „post-rassische“ Gesellschaft erwies sich als trügerisch – weniger Ausdruck gesellschaftlicher Realität als Wunschdenken. In dem Moment, in dem ein Symbol für Fortschritt greifbar wurde, artikulierte sich eine massive Gegenbewegung, die nicht das politische Programm Obamas fürchtete, sondern seine bloße Existenz im Zentrum staatlicher Macht.
Vergeltung statt Versöhnung: Wie die Obama-Ära den Weg für Trump ebnete
Die Wahl Barack Obamas markierte nicht den Abschluss eines historischen Kapitels, sondern die Öffnung eines politischen Ventils. Was sich in seiner Präsidentschaft entfaltete, war weniger ein Konflikt über politische Inhalte als ein tief sitzender kultureller und rassifizierter Abwehrreflex. Die sogenannte Tea-Party-Bewegung, die ab 2009 aufstieg, inszenierte sich als steuerkritische Bürgerbewegung, artikulierte jedoch häufig eine aggressive Ablehnung sozialer Modernisierung – getragen von Slogans wie „Take Our Country Back“ und einer offenen Feindseligkeit gegenüber Gesundheitsreform und Umverteilung, die oft als „versteckte Reparationen“ diffamiert wurden.
Parallel dazu verzeichnete das Southern Poverty Law Center einen drastischen Anstieg rechtsextremer Gruppen: Innerhalb von vier Jahren wuchs die Zahl der sogenannten „Patriot“-Milizen um mehr als das Achtfache. Die Wahl eines Schwarzen Präsidenten wurde zum Auslöser einer politischen Radikalisierung, die von konservativen Medien nicht nur aufgegriffen, sondern systematisch befeuert wurde. Bereits 2009 warnten Sicherheitsbehörden vor dieser Entwicklung – doch statt Alarmbereitschaft auszulösen, wurden sie politisch angegriffen, was die strukturelle Weigerung dokumentierte, das Problem überhaupt zu benennen.
Während Obama versuchte, innenpolitische Reformen umzusetzen – etwa die Ausweitung der Krankenversicherung –, eskalierten gesellschaftliche Spannungen. Die Tötung unbewaffneter Schwarzer Männer durch Polizeikräfte, die Entstehung der Black Lives Matter-Bewegung und deren medial begleitete Gegenerzählung („Blue Lives Matter“, Verteidigung der Polizei, weiße Opferrhetorik) vertieften die Bruchlinien weiter. Obama wurde von seinen Gegner:innen nicht als Präsident unter vielen behandelt, sondern als fundamentale Provokation – als Symbol eines kulturellen Umbruchs, der zurückgedrängt werden müsse.
Die politische Blockadehaltung erreichte unter Mitch McConnell eine neue Dimension: Das erklärte Ziel war nicht Debatte oder Kompromiss, sondern Obstruktion um jeden Preis. Konservative Medien machten Obama zur Zielscheibe permanenter Skandalisierung – ein Schwarzer Präsident wurde nicht als Teil des politischen Spektrums, sondern als Bedrohung der nationalen Ordnung geframet.
Inmitten dieser aufgestauten Spannungen – wirtschaftliche Unsicherheit, kultureller Wandel, das Gefühl verlorener Deutungshoheit – trat Donald Trump auf den Plan. Er bot keine neue Ideologie, sondern eine Identifikationsfläche für jene, die sich durch Obamas Präsenz delegitimiert fühlten. Seine politische Karriere war nicht nur ein Produkt rechter Medien oder wirtschaftlicher Ängste, sondern die konsequente Zuspitzung einer Gegenbewegung, die lange vor ihm begonnen hatte.
Trump als Symptom: Die Rückkehr des Ausschlusses im Gewand der Repräsentation
Donald Trumps Aufstieg war kein politischer Unfall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Verschiebungen. Sein Wahlkampfstart 2015, geprägt von der Diffamierung mexikanischer Migrant:innen und dem Slogan „Make America Great Again“, war weit mehr als Provokation – es war eine bewusst gesetzte Rückbesinnung auf ein kulturelles Ideal, das Ordnung, Kontrolle und ethnische Homogenität versprach. Die Botschaft richtete sich an jene, die sich vom gesellschaftlichen Wandel – verkörpert durch Barack Obama – nicht nur übergangen, sondern existenziell bedroht fühlten.
Trump war weniger ein Bruch mit der Vergangenheit als deren konsequente Zuspitzung. Was viele als Schock oder Ausnahmeerscheinung wahrnahmen, war in Wirklichkeit die Entfaltung lange angelegter Dynamiken: die Normalisierung von politischem Ressentiment, die Aushöhlung institutioneller Standards und die zunehmende Verschmelzung von weißer Identität mit nationalistischer Politik. Seine Kampagne griff nicht bloß politische Themen auf – sie bediente ein tiefes Bedürfnis nach kultureller Rückeroberung.
Wie Ta-Nehisi Coates treffend analysierte, gründete sich Trumps politisches Profil vor allem auf die Negation von Obamas Präsidentschaft. Trump definierte sich als Gegenbild: Er machte sich zur Projektionsfläche für das Gefühl, dass die gesellschaftlichen Fortschritte der vorangegangenen Jahre illegitim gewesen seien. Dabei gab er einer Form weißer Identitätspolitik neue Legitimation – nicht, indem er sie erfand, sondern indem er sie laut, schamlos und öffentlich machte.
Trumps Erfolg zeigte, dass eine erhebliche Zahl von Amerikaner:innen bereit war, liberale Normen und demokratische Spielregeln zu untergraben, wenn diese nicht mehr mit ihrem Selbstbild vereinbar schienen. Seine aggressive Rhetorik wirkte nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer Grenzüberschreitungen. Sie diente als Ventil für das Empfinden, von einer pluralistischen Gesellschaft entfremdet worden zu sein. Das nationale Ideal, auf Gleichheit und Inklusion gegründet, war für viele längst zur Erzählung der „anderen“ geworden. Trump brauchte keine neue Vision – er spiegelte lediglich, was bereits da war.
Autorität ohne Ideologie: Trumps Dekade als Spiegel ungelöster Bruchlinien
Die politische Karriere Donald Trumps von 2015 bis 2025 war kein Ausnahmezustand, sondern Ausdruck tiefer gesellschaftlicher Spaltungen, die lange vor ihm existierten. Seine Präsidentschaft veränderte nicht nur den Ton, sondern die Substanz des demokratischen Selbstverständnisses: Er regierte als Populist im Gewand eines Autokraten, nutzte seine Position nicht zur Vermittlung, sondern zur Eskalation – und machte aus politischem Streit ein permanentes Spektakel der Verachtung.
Trotz seines Reichtums inszenierte sich Trump erfolgreich als Rebell gegen die Eliten. Er delegitimierte unabhängige Institutionen, diskreditierte Medien als „Feinde des Volkes“ und untergrub das Vertrauen in Wahlen und Gerichte. Seine Auftritte wurden zu Bühnen kollektiver Entladung, auf denen Gegner:innen verspottet, bedroht und mit Haft oder Gewalt bedacht wurden – nicht als Ausrutscher, sondern als Strategie. Das politische „Wir“ wurde neu definiert: exklusiv, verletzlich, wütend – und ständig im Kampf gegen ein diffuses „Die da“.
Rhetorik, die vormals als inakzeptabel galt, wurde unter Trump salonfähig. Vorschläge wie ein Einreiseverbot für Muslim:innen, Massenabschiebungen oder die Relativierung rechtsextremer Unterstützung galten nicht mehr als politische Tabubrüche, sondern als authentische Zeichen von Stärke. Die Grenzverschiebung war so wirksam, weil sie nicht versehentlich geschah – sie war gewollt und wurde gefeiert. Die Botschaft: Regeln gelten nur, wenn sie dem eigenen Lager nutzen.
Diese Haltung setzte sich in konkreter Politik fort. Die Trennung von Migrantenkindern an der Grenze, das Verbot von Diversitätstrainings in Bundesbehörden, die gezielte Diskriminierung von Geflüchteten – all das war kein Kontrollverlust, sondern Ausdruck einer autoritär-ethnischen Ordnungsvorstellung. Trumps politische Ideologie bestand nicht in einem kohärenten Programm, sondern in der konsequenten Aufwertung weißer Identität und der Abwertung aller, die davon abwichen.
Die Jahre 2015 bis 2025 markieren damit keine Phase der Entgleisung, sondern eine Entfesselung: Ein erheblicher Teil der Gesellschaft hatte sich längst von der Vorstellung verabschiedet, dass Demokratie auf Inklusion, Pluralität und gemeinsame Fakten angewiesen ist. Trump bot dafür kein neues System – er zerstörte die bestehenden Koordinaten und ersetzte sie durch Loyalität, Feindbildpflege und permanente Eskalation.
Zerstörte Wirklichkeit: Wie die Erosion der Wahrheit zur Strategie wurde
Trumps Aufstieg markierte eine Zäsur nicht nur im politischen Stil, sondern im Verständnis von Realität selbst. In einer Demokratie ist geteilte Wirklichkeit die Voraussetzung für sinnvolle Auseinandersetzung – doch genau dieses Fundament wurde systematisch untergraben. Mit einer Flut an Falschbehauptungen, Übertreibungen und gezielten Desinformationen verschob Trump die Grenzen des Sagbaren so weit, dass die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge zur Nebensache wurde.
Über 30.000 dokumentierte Unwahrheiten allein während seiner ersten Amtszeit sind nicht bloß statistisch bemerkenswert – sie stehen für eine bewusste Strategie: Wahrheit als verhandelbare Größe, Fakten als Meinung. Ob es um Wahlbetrug, Impfstoffe oder Verschwörungsmythen ging – Trumps Politik beruhte auf der Wiederholung von Behauptungen, die jeder Überprüfung standhielten, weil sie nie ernsthaft überprüft werden sollten. Der Begriff „alternative Fakten“, geprägt zur Verteidigung einer offensichtlichen Lüge, wurde zum Symbol eines neuen Machtverständnisses: Realität ist, was dem Führungsanspruch dient.
Die Konsequenz war eine epistemische Krise. Millionen von Menschen lehnten etablierte Informationsquellen pauschal ab und orientierten sich stattdessen an sozialen Echokammern und ideologisch aufgeladenen Medien. In diesem Klima gewannen extreme Narrative – etwa die QAnon-Verschwörung – nicht trotz ihrer Absurdität an Einfluss, sondern gerade deshalb: Sie schufen eine Gegenwelt, in der sich Ohnmacht in Gewissheit verwandeln ließ. Institutionen wie Wissenschaft, Justiz oder Presse galten nicht mehr als prüfende Instanzen, sondern als Feindbilder einer imaginierten Elite.
Was Hannah Arendt einst als Kennzeichen totalitärer Systeme beschrieb – das Auflösen der Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit – wurde unter Trump zur alltäglichen Erfahrung. Der Verlust eines gemeinsamen Referenzrahmens machte öffentliche Verständigung fast unmöglich. Wenn es keine gemeinsam akzeptierten Tatsachen mehr gibt, wird politischer Streit nicht mehr durch Argumente entschieden, sondern durch Macht über Deutung. Genau diese Verschiebung prägt das politische Erbe Trumps – und sie bleibt wirksam, auch über seine Amtszeit hinaus.
Demontage der Demokratie: Wie Macht über Recht gestellt wurde
Trumps Präsidentschaft war geprägt von einem offenen Angriff auf die institutionellen Begrenzungen, die bislang als Selbstverständlichkeiten des amerikanischen Regierungssystems galten. Er regierte nicht im Rahmen der Verfassung, sondern gegen deren Geist – als Führerfigur, der Loyalität wichtiger war als Legalität. Überwachungsinstanzen wie Generalinspekteure, Ermittler:innen und Richter:innen wurden systematisch diskreditiert oder entlassen, wenn sie sich seinem Willen widersetzten. Selbst zweimalige Amtsenthebungsverfahren konnten ihn nicht stoppen – nicht wegen fehlender Beweise, sondern wegen parteipolitischer Gefolgschaft im Senat.
Der Justizapparat wurde zur Waffe in eigener Sache umfunktioniert. Trumps wiederholte Aussagen über eine mögliche dritte Amtszeit oder seine Einflussnahme auf das Justizministerium waren keine bloßen Provokationen, sondern Ausdruck eines autokratischen Anspruchsdenkens. Der republikanischen Partei wurde jede eigenständige Position entzogen – sie wurde zum Instrument persönlicher Machtsicherung und Rachepolitik. Wer widersprach, wurde öffentlich demontiert.
Der Höhepunkt dieser Entwicklung war der versuchte Staatsstreich nach der Wahl 2020. Trotz eindeutiger Wahlniederlage weigerte sich Trump, das Ergebnis anzuerkennen. Stattdessen verbreitete er mit der „Big Lie“ ein Narrativ massiven Wahlbetrugs – ohne Beweise, dafür mit umso größerer Wirkung. Der Glaube an diese Lüge wurde zum Loyalitätstest, der jede institutionelle Wahrheit überlagerte. Am 6. Januar 2021 entlud sich diese Dynamik in einem beispiellosen Gewaltakt: Ein aufgestachelter Mob stürmte das Kapitol, griff Sicherheitskräfte an, bedrohte Abgeordnete und unterbrach erstmals in der modernen Geschichte die friedliche Machtübergabe durch Gewalt.
Die Erstürmung des Kapitols war kein isoliertes Ereignis, sondern die logische Konsequenz eines politischen Klimas, in dem Rechtsstaatlichkeit gezielt ausgehöhlt und institutionelle Gegengewichte entwertet wurden. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt blieb Trumps Einfluss ungebrochen: Wahlverweigerung wurde zur Identität, Gewalttäter:innen zu Märtyrern stilisiert. Der Übergang von autoritärer Rhetorik zu offenem Angriff auf die Demokratie war fließend – und er dauert an.
Die Normalisierung des Ausnahmezustands: Wie das Trump-Lager zur Bewegung wurde
Was mit Donald Trumps Präsidentschaft begann, verwandelte sich in eine dauerhafte politische Kraft: Die MAGA-Bewegung überdauerte nicht nur seine Amtszeit, sie radikalisierte sich weiter. Sie ist heute weniger eine klassische Wählerschaft als ein geschlossenes Weltbild – geprägt von nationalistischem Ressentiment, Polarisierung bis zur Unversöhnlichkeit und der bewussten Aufwertung von Grausamkeit als politischem Ausdruck.
Die zahlreichen Strafverfahren gegen Trump – 88 Anklagepunkte in vier Verfahren, darunter versuchte Wahlumkehr, Betrug und Justizbehinderung – wurden nicht als Zeichen politischer Verfehlung gedeutet, sondern als Bestätigung einer Opferrolle. In der Logik seiner Anhänger:innen ist Trump kein Angeklagter, sondern ein verfolgter Erlöser. Jedes juristische Vorgehen fügt sich nahtlos in das Narrativ einer korrupten Elite, die den „wahren Volkswillen“ unterdrücken wolle.
Diese Umwertung von Skandal zu Auszeichnung ist mehr als mediale Verzerrung – sie verweist auf eine tektonische Verschiebung politischer Maßstäbe. In einem tribalisierten Informationsraum wird moralische Grausamkeit nicht nur toleriert, sondern als Authentizitätsbeweis gefeiert. Ob es sich um die Verspottung eines behinderten Journalisten, die systematische Trennung von Migrantenfamilien oder die Forderung handelt, politische Gegner:innen einzusperren – das Gemeinsame ist nicht der politische Inhalt, sondern die geteilte Verachtung.
Wie der Journalist Adam Serwer schrieb: „Die Grausamkeit ist der Punkt.“ In dieser Haltung wird politische Zugehörigkeit durch das Vergnügen an der Erniedrigung anderer markiert – ein emotionaler Schulterschluss, der sich nicht durch Argumente auflösen lässt. Wo Hass zur identitätsstiftenden Geste wird, verliert die Demokratie ihre verbindende Kraft.
Trumps Rolle bestand nicht darin, diese Dynamik zu erschaffen, sondern sie zu bündeln und zu beschleunigen. Er war weniger der Ursprung als das Symptom eines Systems, dessen normatives Immunsystem – Wahrheitsbindung, institutionelles Vertrauen, gesellschaftliche Toleranz – bereits geschwächt war. Die demokratische Krise, die sich in seiner Ära entfaltete, war lange vorbereitet. Was fehlte, war eine Figur, die bereit war, die Regeln nicht zu brechen, sondern durch ihre Missachtung populär zu werden. Diese Figur fand sich – und die Folgen bleiben.
Zersplitterte Wirklichkeit: Wie Medien und Algorithmen die Wahrheit untergruben
Die politische Eskalation der Trump-Ära war nicht denkbar ohne ein radikal verändertes Mediensystem. In sozialen Netzwerken, die auf maximale Verweildauer optimiert sind, wurde Desinformation nicht bekämpft – sie wurde zur Währung. Algorithmen verstärkten Inhalte, die emotionalisieren, polarisieren und bestätigen, was Nutzer:innen ohnehin glauben wollten. Was einst ein öffentlicher Diskursraum war, wurde in zahllose Echo-Kammern zerschlagen, in denen Fakten zweitrangig und Widerspruch algorithmisch aussortiert wurden.
Der Übergang von extern gesteuerter Einflussnahme – wie durch russische Trolle 2016 – zu inländischer Desinformationsökonomie vollzog sich schnell. Ab 2020 dominierten politische Akteur:innen, extremistische Webseiten und sogenannte Influencer:innen mit verschwörungsideologischer Reichweite die digitale Landschaft. Falschnachrichten zu Wahlen, Pandemien oder politischen Gegner:innen wurden gezielt für virale Wirkung konzipiert: als Meme, Schlagzeile oder Video – leicht teilbar, emotional aufgeladen, scheinbar glaubwürdig. Künstliche Intelligenz beschleunigte diese Entwicklung weiter, indem sie täuschend echte Inhalte produzierte, deren Ursprung kaum noch nachvollziehbar war.
Das Ergebnis war eine fragmentierte Öffentlichkeit ohne gemeinsame Faktenbasis. Die Reaktionen auf zentrale Themen – Impfstoffe, Wahlergebnisse, politische Skandale – hingen weniger von realen Entwicklungen als von personalisierten Informationsblasen ab. Unterschiedliche Informationsquellen produzierten nicht bloß unterschiedliche Meinungen, sondern unvereinbare Weltbilder. Die Debatte verlagerte sich von der Auseinandersetzung mit Positionen hin zur Unmöglichkeit, sich überhaupt auf einen gemeinsamen Sachstand zu einigen.
Glaubwürdigkeit wurde zur Frage der Zugehörigkeit, nicht der Nachprüfbarkeit. Selbst groteske Behauptungen – etwa dass Impfstoffe Mikrochips enthalten oder Wahlen systematisch manipuliert seien – fanden ein Millionenpublikum, solange sie das Gefühl bestätigten, betrogen oder bedroht zu werden. Medien, die solche Narrative verstärkten, agierten nicht mehr als Korrektiv, sondern als Resonanzkörper. In dieser Umgebung verlor Wahrheit ihre orientierende Funktion; sie wurde relativ, verhandelbar – und letztlich entbehrlich.
Zwei Wirklichkeiten, ein Land: Wie Medien Polarisierung zur Struktur machten
Die tiefgreifende Spaltung der amerikanischen Gesellschaft lässt sich nicht mehr allein durch politische Differenzen erklären – sie ist Ausdruck voneinander abgeschotteter Wirklichkeitswahrnehmungen. Besonders der Einfluss parteiischer Kabelsender wie Fox News trug entscheidend dazu bei, dass nicht nur Meinungen, sondern auch Fakten selbst entlang ideologischer Linien zersplitterten. Fox wurde zum erfolgreichsten Nachrichtensender, indem er eine konservative Zielgruppe mit selektiver Information, Angstnarrativen und moralischer Empörung versorgte – oft auf Kosten der faktischen Genauigkeit.
Untersuchungen zeigen, dass Zuschauer:innen von Fox signifikant schlechter über zentrale Ereignisse informiert waren – etwa über das Ausmaß der COVID-Pandemie oder das Versagen der Trump-Regierung. Ein Experiment, bei dem Fox-Zuschauer:innen einen Monat lang CNN sahen, führte zu messbaren Meinungsänderungen: weniger Glaube an Verschwörungen, größere Kritik an Trump. Das deutet darauf hin, dass Medien nicht bloß Einstellungen spiegeln, sondern sie aktiv formen – durch Auswahl, Auslassung und Dauerbeschallung.
Fox News war damit nicht bloß Begleiter einer Polarisierung, sondern ihr Motor. In Verbindung mit sozialen Netzwerken entstand ein Ökosystem, in dem sich jede:r gezielt (oder algorithmisch gelenkt) in eigene Informationsblasen zurückziehen konnte. Inhalte, die Empörung auslösen, verbreiten sich schneller als differenzierte Berichterstattung. Widerspruch wird ausgeblendet, Bestätigung zur einzigen Währung. Gruppen formieren sich entlang geteilter Feindbilder oder ideologischer Narrative, wodurch Extrempositionen weiter verfestigt werden.
Ein besonders drastisches Beispiel war die Wahrnehmung der Präsidentschaftswahl 2020. Während Gerichte Dutzende Klagen wegen angeblichen Wahlbetrugs abwiesen – teils mit Unterstützung republikanischer Amtsträger –, wurde in rechten Medien und Onlineforen eine alternative Realität geschaffen: mit erfundenen Beweisen, systematischer Dramatisierung und permanenter Wiederholung. Das Ergebnis war ein gespaltenes Informationsuniversum: Die eine Seite sah einen klaren Wahlsieg Joe Bidens, die andere einen gestohlenen Staat.
In einem solchen Klima verliert Demokratie ihren gemeinsamen Boden. Wenn Wahrheit nicht mehr kollektiv ausgehandelt, sondern ideologisch produziert wird, wird der politische Konflikt nicht lösbar – weil er nicht mehr um Lösungen, sondern um Realitätsdefinitionen geführt wird. Die Folge ist eine Gesellschaft, in der gemeinsame Fakten nicht mehr existieren, sondern ersetzt wurden durch mediale Zugehörigkeit.
Die Zertrümmerung des Wissens: Wenn Fakten zur Glaubensfrage werden
Der Vertrauensverlust in politische Institutionen hat längst auf Wissenschaft und Expertise übergegriffen – mit lebensbedrohlichen Folgen. Während der COVID-19-Pandemie wurde selbst der einfachste Gesundheitsschutz – Maskentragen, Impfen – zum ideologischen Bekenntnis. Was als medizinischer Konsens galt, wurde in weiten Teilen der rechten Öffentlichkeit als Zumutung oder Verschwörung diffamiert. Das Ergebnis war verheerend: Über eine Million Menschen starben an COVID in den USA, viele davon in Regionen, die medizinischen Empfehlungen bewusst misstrauten. Studien zeigen, dass ein erheblicher Teil dieser Todesfälle vermeidbar gewesen wäre.
Ein ähnliches Muster prägt die Klimadebatte. Trotz jahrzehntelanger wissenschaftlicher Warnungen und zunehmend sichtbarer Katastrophen – Hitzerekorde, Waldbrände, Überflutungen – bleibt ein signifikanter Teil der Bevölkerung skeptisch gegenüber dem menschengemachten Klimawandel. Diese Zweifel sind kein Zufall, sondern Ergebnis gezielter Desinformationskampagnen, finanziert von fossilen Industrien und verbreitet durch mediale Netzwerke, die wirtschaftliche Interessen und ideologische Ablehnung staatlicher Eingriffe vereinen.
Diese systematische Delegitimierung von Fakten schafft ein Umfeld, in dem autoritäre Strömungen gedeihen. Wenn Bürger:innen nicht mehr unterscheiden können, was wahr ist – oder jede Aussage ohnehin für gelogen halten –, wird der Boden für demokratischen Diskurs unfruchtbar. Die Reizüberflutung durch widersprüchliche Informationen erzeugt nicht Erkenntnis, sondern Resignation. In dieser Leerstelle gewinnen vereinfachende, emotionale Narrative an Macht – unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt.
Hannah Arendt beschrieb dies als Zustand, in dem Menschen aufhören, „ihren eigenen Augen und Ohren zu trauen“. In solchen Momenten wird nicht nur die Öffentlichkeit instabil, sondern auch das Selbstverständnis politischer Teilhabe. Die Vereinigten Staaten stehen an einem Punkt, an dem nicht mehr nur die Lösung konkreter Krisen – Pandemien, Klimawandel, soziale Ungleichheit – auf dem Spiel steht, sondern die Grundlage ihrer Bewältigung: ein gemeinsamer Wissensraum, der Verständigung überhaupt erst möglich macht.
Die Wiederherstellung eines belastbaren Informationsraums ist deshalb keine technische, sondern eine zutiefst politische Aufgabe. Ohne gemeinsame Realität zerfällt nicht nur das Vertrauen in Institutionen, sondern auch die Fähigkeit zur Kooperation – und damit das Fundament demokratischer Selbstregierung.
Zwischen Auflösung und Erneuerung: Die USA im Zustand kultureller Zerreißprobe
Die Vereinigten Staaten stehen an einem historischen Kipppunkt. Die Symptome sind unübersehbar: politische Gewalt wird normalisiert, Gegner:innen werden zu Feindbildern erklärt, und selbst tragische Ereignisse – Pandemietote, Schulmassaker – führen nicht mehr zu gesellschaftlicher Selbstprüfung, sondern zu ritualisierter Schuldzuweisung entlang ideologischer Linien. Was früher als Basis demokratischen Miteinanders galt – Respekt, Empathie, Anerkennung des politischen Gegners – wirkt zunehmend wie ein Anachronismus.
Zivile Grundhaltungen erodieren unter dem Druck tribalistischer Logik. Symbole wie Nationalhymne oder Staatsflagge, einst Ausdruck gemeinsamer Identität, werden zu Signalen politischer Lagerzugehörigkeit umgedeutet. Die friedliche Machtübergabe – Fundament jeder Demokratie – ist nicht länger selbstverständlich. In Teilen des politischen Spektrums gilt sie als verhandelbar. Was früher als Verfassungskrise verstanden worden wäre, erscheint heute vielen als legitimes Mittel des Machterhalts.
Historiker:innen ziehen Parallelen zu untergegangenen Republiken: zur späten römischen Republik, die an innerer Zersetzung und populistischer Machtkonzentration zerbrach, oder zur Weimarer Demokratie, deren demokratische Institutionen durch gezielte Verachtung ausgehöhlt wurden. Der Begriff eines „amerikanischen Faschismus“ ist längst nicht mehr rein theoretisch – sondern eine ernstzunehmende Perspektive angesichts zunehmend autoritärer Praktiken und der Erosion normativer Grundlagen.
Gleichzeitig bleibt offen, ob diese Entwicklung unumkehrbar ist. Kulturen zerfallen nicht nur – sie transformieren sich. Auch fundamentale Krisen können Räume für Neudefinition schaffen. Doch eine kulturelle Wiedergeburt, wenn sie überhaupt möglich ist, setzt mehr voraus als bloßen Widerstand gegen den Zerfall. Sie erfordert eine aktive Rekonstruktion gemeinsamer Grundlagen: institutionell, diskursiv und emotional. Ohne ein erneuertes Gefühl für Wahrheit, Mitverantwortung und Pluralität droht nicht nur politischer Verfall – sondern der Verlust jener kulturellen Substanz, auf der die Idee der Republik überhaupt gründet.
Krise als Katalysator: Zwischen kulturellem Zerfall und demokratischer Erneuerung
Trotz aller Zeichen des Verfalls zeigt sich inmitten der Erschütterung auch eine Gegenbewegung – eine lebendige Zivilgesellschaft, die sich nicht abfindet, sondern aufrüttelt. Die Jahre unter Trump und darüber hinaus haben Millionen mobilisiert, nicht in erster Linie als Reaktion auf eine Figur, sondern als Verteidigung einer Idee: dass Demokratie mehr sein muss als institutioneller Rahmen – sie muss gelebte Praxis bleiben. Bewegungen wie der Women’s March 2017 oder die historischen Black-Lives-Matter-Proteste 2020 zeugen davon, dass Empörung auch produktiv werden kann, wenn sie sich mit kollektiver Vision verbindet.
Besonders junge Menschen spielen dabei eine zentrale Rolle. Klimagruppen wie die Sunrise Movement oder Gen-Z-Wähler:innen, die sich mehrheitlich gegen autoritäre und rassistische Politik positionieren, bringen neue Energie in ein System, das lange von Lähmung geprägt war. Wo Desinformation und Apathie wuchern, entstehen gleichzeitig Projekte für Medienkompetenz, politische Bildung und die Reaktivierung bürgerschaftlicher Verantwortung – nicht als Pflicht, sondern als selbstgewählter Auftrag.
Auch institutionell zeigen sich Widerstandskräfte. Journalist:innen trotzen Anfeindungen, Wahlhelfer:innen verteidigen Integrität unter Druck, Gerichte – teils besetzt durch politische Gegner – setzen rechtsstaatliche Grenzen. Solche Beispiele wirken unspektakulär, aber sie sind entscheidend: Sie belegen, dass demokratische Substanz nicht allein in Gesetzen liegt, sondern in der Haltung derer, die sie tragen.
Die kulturelle Auseinandersetzung mit Amerikas Vergangenheit – etwa durch die 1619 Project oder die Entfernung konföderierter Denkmäler – verweist auf eine tiefere Bewegung: weg von nationalem Mythos, hin zu einer ehrlicheren, inklusiveren Selbstbeschreibung. Diese Entwicklung ist konflikthaft, widersprüchlich und alles andere als abgeschlossen. Doch sie zeigt, dass Aufarbeitung nicht bloß rückwärtsgewandt ist – sie schafft die Voraussetzungen für neue politische Imagination.
Die Vereinigten Staaten haben sich in ihrer Geschichte mehrfach neu erfunden – nicht trotz, sondern wegen der Krisen, die sie erschüttert haben. Die Frage, ob eine Republik sich nach der Versuchung zum Autoritarismus regenerieren kann, wird nicht theoretisch beantwortet, sondern durch konkrete Handlungen von Menschen, die sich dem Zerfall nicht überlassen. In dieser Spannung zwischen Spaltung und Erneuerung entscheidet sich nicht nur die Zukunft Amerikas – sondern die seiner demokratischen Idee selbst.
Am Scheideweg der Republik: Die Wahl zwischen Beharrung und Erneuerung
Die gegenwärtige Krise könnte mehr sein als ein Zeichen des Zerfalls – sie könnte ein historischer Wendepunkt sein. Das Ausmaß der politischen, kulturellen und institutionellen Erschütterung zwingt zur Auseinandersetzung mit Widersprüchen, die das Land seit seiner Gründung prägen. Wer von dieser Krise nur den Zerfall erwartet, übersieht die Möglichkeit einer Neuordnung – durch strukturelle Reformen, kulturelle Selbstbefragung und eine wiederbelebte demokratische Praxis.
Denkbar sind tiefgreifende Veränderungen: gesetzliche Sicherungen für faire Wahlen, die Begrenzung des Einflusses von Geld in der Politik, eine strengere Regulierung algorithmischer Informationssysteme, vielleicht sogar Verfassungsänderungen. Solche Maßnahmen könnten die Demokratie nicht nur stabilisieren, sondern zukunftsfähig machen. Parallel dazu wächst ein Bedürfnis nach gemeinsamer Orientierung – eine leise, aber spürbare Ablehnung des politischen Nihilismus, der viele Debatten dominiert hat.
Doch diese Möglichkeit bleibt prekär. Die Kräfte der Beharrung sind stark: mediale Fragmentierung, ökonomische Machtkonzentration, ideologische Polarisierung. Der Weg zur Erneuerung ist weder garantiert noch geradlinig. Sollte es nicht gelingen, diese Dynamiken zu durchbrechen, droht ein schleichender demokratischer Rückbau – eine Phase, in der zentrale Institutionen weiter entwertet und politische Gegensätze unüberbrückbar werden. Selbst Gedankenspiele über eine Spaltung in „rote“ und „blaue“ Staaten, einst undenkbar, sind Ausdruck dieser Vorstellungskraft der Auflösung.
Wie sich dieser historische Moment entfaltet, hängt entscheidend von zwei Faktoren ab: verantwortungsbewusster Führung und aktiver Beteiligung der Bürger:innen. Die Geschichte bietet beides – Mahnung und Hoffnung. James Baldwins Einsicht, dass der amerikanische Traum auf Kosten der Ausgebeuteten verwirklicht wurde, verweist nicht nur auf Schuld, sondern auf Gestaltungsmacht: Die Entscheidung, ob dieser Traum allen gehören kann, ist offen. Martin Luther Kings Bild vom moralischen Universum, das sich nur durch beharrliches Ziehen in Richtung Gerechtigkeit beugt, macht deutlich: Fortschritt ist niemals automatisch.
Die gegenwärtige Generation steht vor genau dieser Aufgabe. Die Frage ist nicht, ob Amerika seine Ideale je vollständig verwirklicht hat, sondern ob es noch den Willen hat, sie erneut zu behaupten. Zwischen Zerbrechen und Neubeginn liegt keine historische Notwendigkeit – sondern eine Entscheidung.
Wann starb der Traum? Eine Chronik der schleichenden Erosion
Der amerikanische Traum – verstanden als Ideal von Freiheit, Gleichheit und demokratischer Teilhabe – starb nicht in einem Moment. Er verblasste schrittweise, erodierte in Etappen, und war zugleich nie vollständig unversehrt. Von Beginn an war er durch fundamentale Auslassungen kompromittiert. Die Republik, gegründet auf der Idee universeller Rechte, schloss ganze Bevölkerungsgruppen kategorisch aus. Schon Frederick Douglass stellte 1852 die zentrale Frage: Was bedeutet der Unabhängigkeitstag für den Menschen in Ketten?
Der Traum war nie unumstritten, sondern wurde immer wieder erweitert, untergraben, neu formuliert. Die Kompromisse mit der Sklaverei in der Gründungsphase schwächten ihn, bevor er sich entfalten konnte. Das Scheitern der Reconstruction nach dem Bürgerkrieg, als nationale Einheit über rassische Gerechtigkeit gestellt wurde, stellte ein frühes Signal des Rückzugs dar. In der Gilded Age wurde politische Gleichheit durch wirtschaftliche Oligarchie untergraben – die Vorstellung von fairem Aufstieg blieb Illusion für viele.
Auch das 20. Jahrhundert brachte keine Kontinuität des Fortschritts. Der McCarthyismus zeigte, wie leicht Angst bürgerliche Freiheiten aushebeln kann. Die späten 1960er-Jahre, geprägt von politischen Morden, urbaner Revolte und weißer Gegenreaktion, markierten den Zerfall des liberalen Konsenses. Die 1980er leiteten eine neue Ordnung ein: Mit Ronald Reagans rhetorischem Optimismus kam ein Sozialdarwinismus zurück, der Solidarität als Schwäche deutete und Umverteilung als Fehler.
Nach dem 11. September 2001 wurde die demokratische Selbstsicherheit durch Sicherheitsdenken ersetzt. Die Invasion des Irak beschädigte Amerikas moralische Glaubwürdigkeit ebenso wie seine außenpolitische Urteilskraft. Die Finanzkrise von 2008 machte endgültig sichtbar, dass Deregulierung und Marktgläubigkeit nicht zur allgemeinen Teilhabe führten, sondern zur Verfestigung wirtschaftlicher Ungleichheit. Und 2016, mit Trumps Wahlsieg, fiel endgültig die Maske des nationalen Fortschrittsnarrativs: Autoritäre Reflexe, rassistische Denkfiguren und antidemokratische Affekte rückten ins Zentrum des politischen Raums.
Jede dieser Wegmarken könnte als Riss in der Oberfläche des Traums gelten. Doch nicht eine allein brachte sein Ende – es war das Zusammenspiel aus strukturellen Kompromissen, verdrängter Geschichte und ideologischer Selbsttäuschung. Der Traum war weniger ein klares Versprechen als ein ständiger Aushandlungsprozess, der immer wieder drohte, zum Mythos zu verkommen.
Wenn der Traum gestorben ist, dann nicht als plötzlicher Bruch – sondern als langsames Verblassen einer Idee, die nie vollständig eingelöst wurde. Ob er neu belebt werden kann, hängt nicht von seiner Geschichte ab, sondern davon, ob die Gegenwart noch bereit ist, ihn als Auftrag zu begreifen.
Nicht gestorben, sondern nie eingelöst: Der amerikanische Traum als Spiegel seiner Widersprüche
Wenn eine eindeutige Antwort verlangt ist, dann lautet sie womöglich: Der amerikanische Traum ist nicht gestorben – er wurde nie vollständig verwirklicht. Gerade deshalb blieb er durchgehend anfällig für Verzerrung, Aushöhlung und Vereinnahmung. Was heute wie ein dramatischer Zusammenbruch wirkt, ist vielmehr die Kulmination lang verdrängter Widersprüche: strukturelle Ungleichheit, kulturelle Selbsttäuschung und eine politische Kultur, die Konflikt eher inszeniert als bearbeitet.
Trumps Aufstieg markiert keinen plötzlichen Bruch, sondern eine Enthüllung. Er ist nicht der Ursprung der Krise, sondern deren Symptom und Beschleuniger. Er verkörpert das, was lange im Schatten lag: die Abwertung von Wahrheit, die Normalisierung von Grausamkeit, die Sehnsucht nach autoritärer Führung, die Verachtung gegenüber Expertise – und eine politische Öffentlichkeit, in der Hass zur Währung geworden ist. Seine Macht entstand nicht aus dem Nichts, sondern aus einem Nährboden unbeantworteter Fragen und moralischer Erosion.
Der oft zitierte Satz, dass Amerika groß sei, weil es gut sei – und seine Größe verlieren werde, wenn es aufhört, gut zu sein – verweist auf ein Selbstbild, das längst in Frage steht. Was bedeutet „gut sein“ in einem Land, das bereit war, einen offen lügenden, spaltenden Führer nicht nur zu tolerieren, sondern zu feiern? Die Antwort liegt nicht nur im politischen Scheitern, sondern in der Bereitschaft breiter Teile der Gesellschaft, mitzutragen, was einst unvorstellbar war.
James Baldwins Worte klingen heute dringlicher denn je: Viele Menschen in den USA – Schwarze, Arme, Marginalisierte – haben nie geglaubt, dass das Land, dem sie formell angehören, auch ihnen verpflichtet sei. Was sich verändert hat, ist die Sichtbarkeit dieser Kluft. Die Fiktion einer funktionierenden Republik, getragen von geteilten Werten, lässt sich nicht länger aufrechterhalten – auch nicht für jene, die sie bisher ignorieren konnten.
Trump war nie bloß eine Person. Er war – und ist – ein Spiegel. Wer hineinsieht, erkennt weniger ihn als das, was sich in der amerikanischen Gesellschaft über Generationen angestaut hat. Die entscheidende Frage bleibt nicht, wann der Traum starb. Sie lautet: Wann wurde klar, dass viele ihn nie träumen durften – und was daraus folgt, wenn das niemand mehr übersehen kann.
Zwischen Abgrund und Aufbruch: Die amerikanische Demokratie im Spiegel ihrer eigenen Geschichte
Hannah Arendt sah in Zynismus und Leichtgläubigkeit zwei Seiten derselben Medaille – beide zerstören die Fähigkeit, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, und bereiten den Boden für autoritäre Herrschaft. In den USA hat sich genau diese gefährliche Mischung verfestigt: Misstrauen gegenüber Institutionen und Fakten geht einher mit der Bereitschaft, an immer groteskere Erzählungen zu glauben. Diese Entwicklung kam nicht plötzlich. Sie ist das Ergebnis jahrzehntelanger politischer und kultureller Erosion – ein schleichender Prozess, der die Fundamente des republikanischen Selbstverständnisses untergraben hat.
Ob das amerikanische Projekt zwangsläufig in diese Krise münden musste, bleibt offen. Wer die Geschichte als lineare Folge der „original sins“ – Sklaverei, Kolonialismus, Ausschluss – versteht, wird in der Gegenwart eine logische Konsequenz erkennen. Tatsächlich beschrieb Abraham Lincoln schon 1838 ein „böses Omen“: Wenn Amerika zu Fall komme, dann nicht durch äußere Feinde, sondern durch Selbstzerstörung. Seine Warnung wirkt heute wie eine düstere Vorwegnahme der inneren Zerrissenheit, die den demokratischen Zusammenhalt akut bedroht.
Doch in der amerikanischen Geschichte liegen nicht nur Mahnungen, sondern auch Belege für Selbstkorrektur. Tocqueville sah bereits im 19. Jahrhundert das zentrale moralische Risiko: Die Missachtung Schwarzer und indigener Menschen könne die Glaubwürdigkeit der Demokratie untergraben. Und dennoch: Bürgerkriege wurden geführt, Rechte erkämpft, Missstände benannt – nie vollständig, nie schnell genug, aber unübersehbar. Das Versprechen wurde nicht erfüllt, doch es wurde nie ganz aufgegeben.
Gerade die Jahre unter Trump haben einen neuen Impuls erzeugt. Die Dunkelheit hat Gegenkräfte mobilisiert: junge Menschen, die sich politisch einmischen; Bewegungen, die demokratische Prinzipien nicht nur verteidigen, sondern weiterdenken; Initiativen, die nicht nur Institutionen schützen, sondern ihre Reichweite ausweiten wollen. In dieser Reaktion liegt eine stille Hoffnung: Dass der amerikanische Traum – in seiner tiefsten Form ein Projekt kollektiver Selbstbefragung – nicht tot ist, sondern immer wieder zum Leben gezwungen werden muss.
Die Krise ist real. Doch sie ist nicht zwangsläufig das Ende. Vielmehr stellt sie erneut die Grundfrage: Ob eine Gesellschaft bereit ist, sich der Wahrheit über sich selbst zu stellen – und daraus den Mut zur Veränderung zu ziehen.
Am Rand – oder am Anfang? Die Entscheidung liegt bei uns
Donald Trumps Aufstieg war kein Betriebsunfall der Geschichte, sondern Ausdruck und Beschleuniger lang bestehender Widersprüche. Er hat nichts Fremdes eingeführt, sondern sichtbar gemacht, was immer schon da war: das Auseinanderklaffen zwischen dem Versprechen Amerikas und seiner Wirklichkeit. Von Anfang an war das Ideal von Gleichheit und Freiheit exklusiv gedacht – es schloss mehr aus, als es einschloss. Diese strukturelle Spannung zieht sich durch über 250 Jahre nationaler Geschichte.
Trumps Bewegung – offen autoritär, faktenfeindlich, illiberal – ist die bisher schärfste Zuspitzung jener inneren Kämpfe. Sie stellt die Grundfrage neu und dringlicher als je zuvor: Kann das amerikanische Versprechen, immer wieder erneuert, überleben? Oder wird es von den Kräften überrollt, die es von Anfang an unterlaufen haben?
Es gab keinen Moment, in dem der Traum endgültig starb. Er flackerte, verschwand, kehrte zurück. Die Frage ist nicht, wann er verloren ging – sondern ob wir zulassen, dass er jetzt endgültig versiegt. Die Antwort hängt nicht von Symbolen oder Führungsfiguren ab, sondern von der kollektiven Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen: für die Geschichte, die erzählt wird, und die Zukunft, die daraus entsteht.
Wenn es gelingt, sich der verdrängten Vergangenheit zu stellen, Vertrauen und Wahrhaftigkeit neu zu begründen und eine gemeinsame Vorstellung von Gerechtigkeit und Zugehörigkeit zu formulieren, dann könnte dieses Jahrzehnt nicht als Niedergang, sondern als Wendepunkt in Erinnerung bleiben. Wenn nicht, wird es als letzte Phase eines republikanischen Projekts erscheinen, das nie gelernt hat, seine eigenen Widersprüche zu heilen.
Die Geschichte ist offen. Und sie wird nicht von anderen geschrieben. We, the People – wir halten die Feder in der Hand.

 By Jakob Montrasio
By Jakob Montrasio