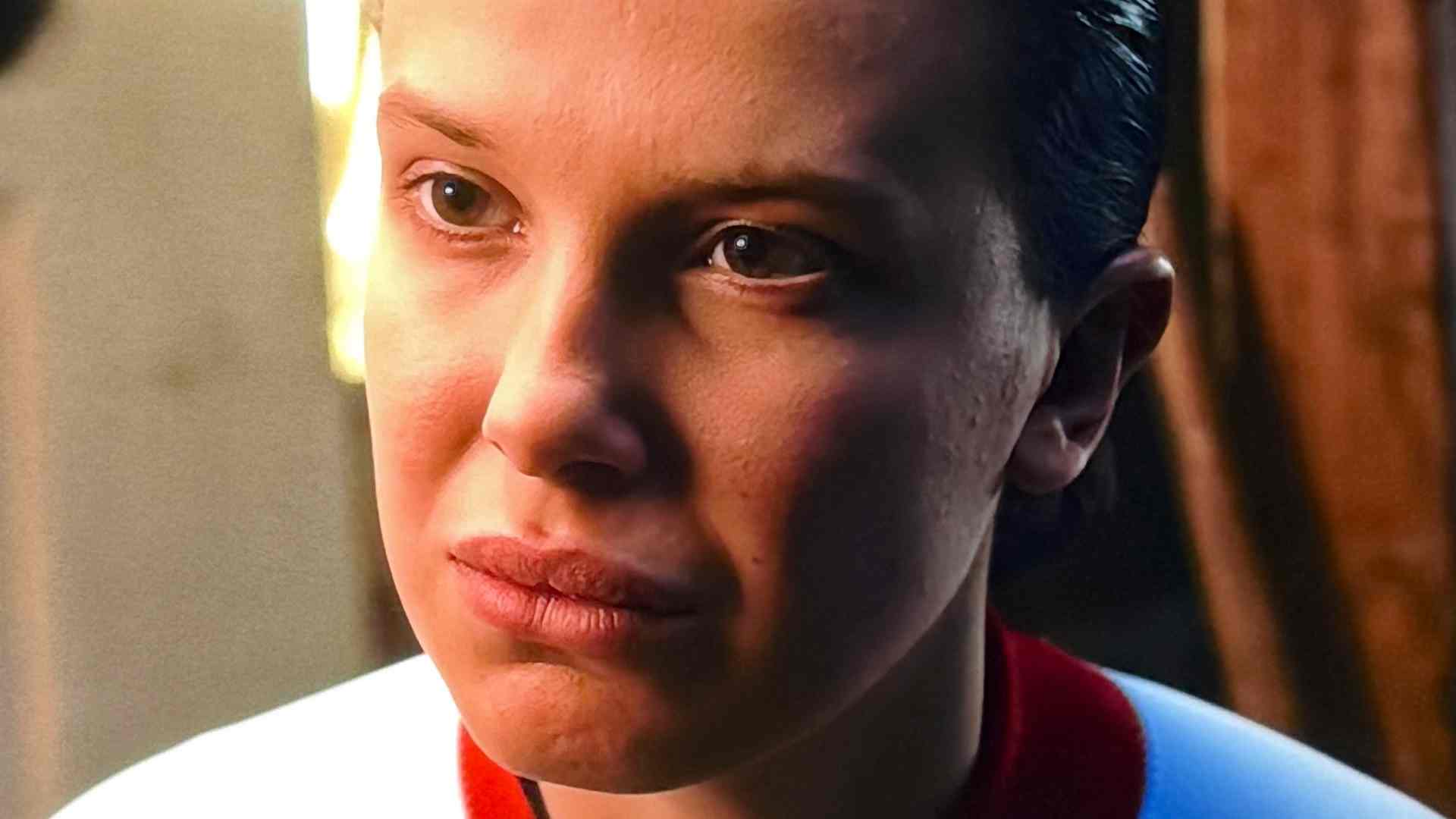„Arang“ – Koreas verspäteter Abklatsch des japanischen Horrors
Manchmal beginnt ein Film mit einem vertrauten Schauer. Eine Frau mit langen, schwarzen Haaren. Ein kaltes Flackern im Bildschirm. Blut, Schatten, ein leises Rauschen.
Klingt bekannt? Ist es auch.
Arang, der koreanische Horrorfilm von 2006, greift alles auf, was uns seit Ringu und The Grudge das Fürchten lehren sollte – und stolpert dabei über seine eigenen Altbekanntheiten. Nur leider acht Jahre zu spät.
Wenn Polizisten Geister jagen
Im Zentrum steht eine Polizistin, die man zu Beginn noch für zäh hält – bis man merkt, dass ihre Trägheit eher aus dem Drehbuch als aus Trauma kommt. Zusammen mit einem übermotivierten Neuling soll sie eine Reihe mysteriöser Todesfälle aufklären.
Die Opfer – junge Männer, wie aus dem Klischeealbum gerissen – sterben kurz nachdem sie eine rätselhafte E-Mail mit einem Link zu einer noch rätselhafteren Webseite bekommen. Und wer einmal klickt, hat schon verloren: Die geisterhafte Frau mit den blutigen Augen kriecht aus Dunkelheit, Blutlachen, Wänden – aus allem, was nass, schwarz und gruselig aussieht.
Was als Krimi beginnt, mutiert bald zu einem Geisterrätsel, das sich selbst nicht versteht. Zwischen Polizistenlogik („Das ergibt keinen Sinn, also muss es stimmen“) und Spukmomenten aus der Konserve taumelt die Geschichte voran – irgendwo zwischen Mystery-Thriller und unfreiwilliger Parodie.
Logik sucht Ausgang
Arang leidet unter dem schlimmsten aller Horror-Fehler: Er nimmt sich ernst, ohne dafür Gründe zu liefern.
Die Ermittlungen sind ein wildes Sammelsurium aus Pseudo-Hinweisen und hanebüchenen Entscheidungen. Die Protagonistin zerschneidet plötzlich einen Hund – warum? Niemand weiß es. Der Geist wartet acht Jahre, bevor er loslegt – weil… ja, warum eigentlich?
Und das Ende, das mit einer „großen Wendung“ überraschen will, lässt eher ein Schulterzucken zurück. Gibt es Geister? Oder sind sie bloß Metaphern? Der Film selbst scheint es vergessen zu haben.
Wenn Tropen müde werden
Die langehaarige Frau.
Die tragische Vergangenheit.
Die Rache aus dem Jenseits.
Alles schon gesehen, alles schon erzählt. Nur diesmal ohne Seele, ohne Mut, ohne eigene Handschrift.
Während andere koreanische Filme jener Zeit (Oldboy, A Tale of Two Sisters, Tale of Cinema) kreative Risiken eingingen, bleibt Arang brav im Schatten japanischer Vorbilder. Fast wirkt es, als hätte jemand einen Algorithmus mit Stichworten gefüttert – „Fluch, Wasser, Mädchen, Blut, Schuld“ – und gehofft, das Ergebnis werde schon gruselig genug sein.
Doch was bleibt, ist ein Film, der zwar nach Horror aussieht, aber keiner ist.
Er erschreckt nicht, er bewegt nicht, er tut einfach… nichts.
Das Ende einer Welle
In den frühen 2000ern war asiatischer Horror ein Phänomen – roh, neu, beunruhigend. Arang wirkt dagegen wie der Moment, in dem die Welle an den Strand klatscht und nur noch Schaum hinterlässt.
Sogar die Moral, „Die Liebe siegt!“, wirkt angeklebt – als hätte jemand am Ende schnell noch versucht, eine Bedeutung nachzureichen.
Dabei kann koreanisches Kino so viel mehr.
Es kann verstören (Memories of Murder), verzaubern (Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring), erschüttern (Peppermint Candy).
Aber Arang? Es bleibt ein leeres Echo dieser Größe – ein Film, der seinen eigenen Schatten jagt.
Fazit: ein Fluch ohne Wirkung
Arang ist der Versuch, den Geist des J-Horror nach Korea zu importieren – nur dass auf dem Weg offenbar das Herz verloren ging.
Für eingefleischte Genre-Fans mag er noch ein gewisses Retro-Gefühl wecken, für alle anderen bleibt er eine zähe Wiederholung altbekannter Spukmuster.
Am Ende sitzt man da, schaut den Abspann und denkt:
Nicht jeder Geist verdient es, wiedergeboren zu werden.

 By Jakob Montrasio
By Jakob Montrasio